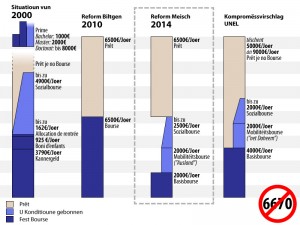Von konservativer Hysterie und linker Euphorie
Den 5. Dezember könnte man als historischen Tag für die deutsche Linke bezeichnen: Erstmals wurde mit Bodo Ramelow in Thüringen ein linker Ministerpräsident gewählt – wenn auch mit einer denkbar knappen Mehrheit.
Unterstützt wird die Linke – die Partei, die diesen Namen trägt, wohlgemerkt – dabei von der SPD und den Grünen, die ähnlichen Koalitionsvorhaben auf Bundesebene eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen; und so haben einige mehr oder weniger prominente Sozialdemokraten und Grüne auch erklärt, die Rot-Rot-Grüne Koalition in Thüringen nicht gutzuheißen.
Und die CDU ist regelrecht beleidigt und tut sich in Erfurt mit Neonazis und der rechtspopulistischen AfD zusammen, um gegen eine Regierung unter Ramelow zu protestieren – und bedient sich dabei natürlich antikommunistischer Rhetorik, als stünde die Mauer immer noch.
Doch auch viele Linke sind skeptisch – und diese Skepsis ist nicht unbegründet. Schon in Berlin erwies sich die Beteiligung der Linken an einer SPD-geführten Regierung als regelrechte Katastrophe. Die Linke ließ sich hier zum Steigbügelhalter sozialdemokratischer Machtpolitik degradieren und privatisierte etwa die landeseigene Wohnbaugesellschaft GSW widerstandslos, um nur ein Beispiel zu nennen.
Auch in Brandenburg machte die Rot-Rote Koalitionsregierung sich keine Freunde unter umweltbewussten Linken, als sie den Abbau der Braunkohle weiter förderten – nachdem die Partei 2009 noch Wahlkampf gegen die Erschließung neuer Tagebaue machte.
Was erwartet uns in Thüringen?
Nun kann man natürlich nicht in die Zukunft sehen und weiß daher noch nicht, wie sich die Rot-Rot-Grüne Koalition wirklich auf die sozialen Umstände in Thüringen auswirken wird – und ob sie sich wirklich als fortschrittliche Koalition erweist, die die beschränkten Mittel nutzt, die ihr zur Verfügung stehen, um im Rahmen ebendieser mehr soziale Gerechtigkeit herbeizuführen oder sie sich, im schlimmsten Falle, doch als machtpolitischer Reinfall wie in Berlin herausstellen wird.
Momentan bleibt also nicht mehr, als auf die begrenzten Kompetenzen der Länderpolitik hinzuweisen – Thüringen wird jetzt sicher nicht den Weg zum Sozialismus einschlagen können – und auf die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, aus denen man aber auch lernen kann.
Koalitionsvertrag der „sozial-ökologischen Modernisierung“.
Einen ersten Einblick darin, was die Thüringer die nächsten Jahre erwartet, bekommt man aber auch vom Koalitionsvertrag der drei beteiligten Parteien. Tatsächlich zeigen sich hier einige progressive Momente, wie etwa die Einführung einer Mietpreisbremse für Städte, in denen es ein Problem mit Mietpreissteigerungen gibt, von Zuschüssen für die Schaffung von sozialen Wohnungsraum und die Förderung von kommunalem und genossenschaftlichen Wohnungsbau – um nur Beispiele aus der Wohnungspolitik zu nennen.
Aber auch die mögliche Einführung eines Sozialtickets, die Einstellung von 500 zusätzlichen Lehrern pro Jahr und ein kostenloses Kindergartenjahr sind fortschrittliche Unterfangen, wenn sie denn alle durchgesetzt werden.
Ein Problem stellt hier aber die Beibehaltung der Schuldenbremse dar und das Vorhaben, keine Neuverschuldung mehr zuzulassen. Dies könnte sich aller Wahrscheinlichkeit nach als Reformbremse erweisen, besonders wenn man bedenkt, dass viele der angestrebten Reformen, auch im wirtschaftlichen Bereich, wo kleine und mittlere Unternehmen und damit auch regionale Wirtschaftskreisläufe explizit gefördert werden sollen, durchaus vermehrte Ausgaben mit sich bringen.
Eingeschränkte Kompetenzen und „schwarze Null“.
Wenn sich eine linke Partei also auf eine Regierungsbeteiligung auf regionaler oder lokaler Ebene einlässt, so müssen sich die Akteure dieser Partei bewusst sein, dass ihre Handlungsmöglichkeiten durch die auf dieser Ebene gegebenen Kompetenzen stark eingeschränkt werden.
So kann die Linke in Thüringen etwa nicht dem Anspruch der Linken auf Bundesebene gerecht werden, die Hartz-IV-Reformen rückgängig zu machen und keine Kriege mehr von deutschem Boden ausgehen zu lassen und kann nur beschränkte soziale Fortschritte erzielen.
Aber auch die vorherrschende politische Ideologie schränkt die Handlungsmöglichkeiten ein: Die Forderung der SPD nach der „schwarzen Null“, also des Verzichts auf Neuverschuldung, etwa ist Ausdruck des liberalen Irrglaubens, man könne einen politischen Haushalt nach den Prinzipien eines privaten Haushalts führen; man bräuchte nur zu „sparen“, dann würde sich die budgetäre Stabilität schon ergeben. Als Linker aber sollte man sich bewusst sein, dass die Ideologie des „Sparens“ soziale, demokratische und ökologische Reformen noch weiter einschränkt.
Linke Regierungsbeteiligung – wann macht sie Sinn?
Ohne die Rot-Rot-Grüne in Thüringen voreilig schlechtreden zu wollen, muss man sich also immer vor Augen halten, dass linke Regierungsbeteiligungen nur dann Sinn machen, wenn sie konkret auch zu notwendigen Reformen führen. Eine Koalition, die nur darauf aus ist, eine vorher politisch dominierende Partei abzulösen, ohne konkrete soziale Alternativen zu bieten, macht, aus linker Sicht, keinen Sinn; diese wäre nur machtpolitisch zu rechtfertigen. Machtpolitik kann aber nicht das Ziel einer linken Partei sein.
Es wäre also nötig, vom gesellschaftlich und politisch allzu akzeptierten und umjubelten Spardiskurs abzukommen, und klarzumachen, dass soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Demokratie nun einmal nicht kostenlos sind – und Mehrausgaben fordern.
Wenn sich die betroffenen Parteien darin einig sind, dann, und nur dann, macht eine Koalition mit linker Beteiligung Sinn. Ob die thüringische Beteiligung der Linken an einer Regierung mit SPD und Grünen Sinn macht, wird sich die nächsten Jahre herausstellen. Bis dahin sollten einige Linke aber ihren Enthusiasmus etwas herunterfahren.